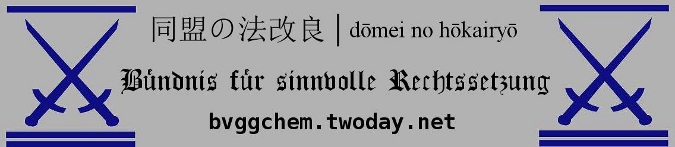10 Punkte gegen die E-ID – ein Argumentum
Ende diesen Monats, am 28. September 2025 wird die Abstimmung über das E-ID-Gesetz stattfinden. Wie das Magazin REPUBLIK zum Thema völlig richtig schreibt, stehen wir an einem Scheideweg in der Digitalisierung, vor einem Übergang des grundsätzlich anonymen, freien Internets in eine neue Welt mit staatlichen digitalen Identitäten, die jederzeit überprüfbar sind.
Wir empfehlen, diesen Weg nicht einzuschlagen, denn die Nachteile, Probleme und Risiken welche die E-ID mit sich bringt, sind deutlich grösser, als der mögliche Nutzen.
Es gibt folgende Punkte zu bedenken:
„Gute Digitalisierung braucht keine Überwachung!“
Wir empfehlen, diesen Weg nicht einzuschlagen, denn die Nachteile, Probleme und Risiken welche die E-ID mit sich bringt, sind deutlich grösser, als der mögliche Nutzen.
Es gibt folgende Punkte zu bedenken:
- Die E-ID wird mit einem Smartphone verknüpft.
Das ist unklug, denn diese mobilen Geräte sind sehr anfällig für Sicherheitslücken, die letzte Warnung vor einer erheblichen Gefahr in iOS (dem Betriebssystem für iPhones) ist gerade mal zwei Wochen alt. So warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu Recht auch besonders vor den speziellen Sicherheitsrisiken mobiler Geräte bei E-Banking.
- Die E-ID ist NUR für Smartphones,
nicht für Computer & Laptops vorgesehen.
Der weltweite Datenverkehr besteht zu 42% aus Computer- und Laptopbenutzern, diese von der Digitalisierung auszuschliessen, ist Rückschritt, nicht Fortschritt, auch sensible amtliche Dokumente wie der Strafregisterauszug konnten ohne digitale Identität angefordert werden.
- Die E-ID ist an das Gerät gebunden und nicht transferierbar.
Wer sein Smartphone verliert oder auf ein neues Modell wechselt, muss auch eine neue E-ID beantragen. Das ist unpraktisch und technisch veraltet. Die E-ID wird in einer Wallet-App gespeichert, solche „elektronischen Brieftaschen“ sind bei Kryptowährungen gängig und verfügen immer über eine sogenannte Seed-Phrase, mit welcher sie bei defekter Hardware wiederhergestellt oder bei Bedarf problemlos von Gerät zu Gerät übertragen werden können.
Die E-ID sieht diese wichtige Funktion nicht vor, sie ist somit auch technisch unausgegoren.
- Die E-ID wird per Gesichtserkennung zertifiziert.
Das schafft Risiken und ist unsicher.
Der Gesichtsbildabgleich erfolgt laut Pressekonferenz des Bundesrats als „Video-Selfie“, man soll sein Gesicht mit der Smartphone-Kamera in unterschiedlichen Winkeln filmen.
Das ist keine gute Idee. Denn solche Videos sind perfekt geeignet, um per KI sogenannte Deepfakes zu erstellen, Fälschungen von Wort, Gesicht und Stimme, die von Kriminellen zur Erpressung, für Enkeltricks und Identitätsdiebstahl benutzt werden. Neuronale Netze brauchen dazu nur wenige Videominuten in hoher Qualität aus verschiedenen Perspektiven.
Biometrie für Sicherheitsanwendungen ist zudem generell unbrauchbar, sie gaukelt wegen der Einzigartigkeit der Merkmale einen hohen Schutz vor, den sie gar nicht leisten kann. Alle biometrischen Sicherheitsmethoden sind geknackt, ob nun Fingerabdruck oder Iris-Scanner, auch die Gesichtserkennung ist denkbar einfach überwunden, mit Photo und Stift.
- Die E-ID führt viele Personendaten zusammen
und erhöht so das Risiko für Hacking.
Alle Passdaten (Name, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Heimatort, Nationalität), das Gesichtsbild sowie die AHV-Nummer werden per E-ID auf dem Smartphone vorgehalten.
Jede Ansammlung von Personendaten in einem einzigen Gerät macht dieses deutlich attraktiver für Angreifer, da sie nur noch eines statt mehrere Systeme kompromittieren müssen, um effektiv Daten stehlen, Schadsoftware platzieren, Bewegungsprofile anlegen oder Gespräche belauschen zu können. Das Risiko, Opfer von Computerkriminalität zu werden, nimmt daher mit der E-ID zu, unabhängig davon, wie sicher diese selbst ist.
- Die E-ID fördert die Untrennbarkeit privater und beruflicher Daten. Das persönliche Smartphone ist für viele Menschen in erster Linie ein privates Gerät, das zur Kommunikation mit Freunden, Familie, in den sozialen Medien und dem Surfen im Internet genutzt wird. Auch wenn eine Verwendung im beruflichen Alltag nicht unüblich ist, werden wichtige Transaktionen darüber in der Regel eher nicht abgewickelt.
So raten zu Recht etwa auch Versicherungen dazu, aus Sicherheitsgründen für private und geschäftliche Kommunikation verschiedene Geräte zu benutzen, wann immer dies möglich ist.
Die E-ID durchbricht diese sinnvolle Trennung, in dem sie das persönliche Smartphone durch die Verknüpfung der Passdaten zu einem digitalen Ausweisdokument umwandelt.
Natürlich liesse sich dieses Problem durch Erwerb und Benutzung eines Zweitgeräts (zumindest solange Mobiltelefonverträge noch ohne E-ID zu bekommen sind) umgehen. Dies zu erwarten ist jedoch unrealistisch. Auch für IT-Sicherheit gilt, dass sich ein niedriger Standard aus Bequemlichkeit in der Praxis durchsetzt, wenn er für den Nutzer einfacher ist.
- Die E-ID bietet Freiwilligkeit nur auf Zeit.
Die E-ID wirbt sehr offensiv mit ihrer Freiwilligkeit. Das sollte misstrauisch machen. Erfahrungsgemäss führt die Einführung staatlicher neuer Technologie auch bei anfänglicher Freiwilligkeit – insbesondere bei beharrlicher Ablehnung durch das Publikum – zu einem schleichenden Benutzungszwang, um die Kosten der scheiternden Technik zu rechtfertigen.
So war etwa die elektronische Einreichung von Beschwerden ans Bundesgericht seit 2007 möglich, aber immer sehr unbeliebt und stagnierte bei zuletzt 7% (2024: 553/7493 = 7.4 %). Als Konsequenz daraus, dass die elektronische Beschwerde damit von der Zielgruppe ganz überwiegend nicht angenommen wurde, ist sie jetzt – jedenfalls in Zürich – obligatorisch.
Insofern ist die Freiwilligkeit der E-ID wohl auch eher als Übergangsfrist zu verstehen.
Aber auch ohne Blick in die Zukunft ist die Freiwilligkeit der E-ID schon jetzt klar absehbar begrenzt, denn die Eintragung in das neue Organspenderegister, welches die verbindliche Zustimmung oder den Widerspruch zur Organspende (wobei nach Widerspruchslösung zustimmt, wer nicht wirksam widerspricht) festhält, wird nur per E-ID möglich sein.
- Die E-ID birgt die Gefahr der Überidentifikation.
Die E-ID weist eine leicht verfügbare, jederzeit verwendbare Identifikationsmöglichkeit auf. Eine solche Infrastruktur verführt dazu, sie auch dort einzusetzen, wo die Identifikation nicht (zwingend) notwendig ist. Die Ausweispflichten in der Schweiz könnten sich so sprunghaft ausweiten und werden dies voraussichtlich auch, denn eine neue ist bereits beschlossen, der Zugang zu Youtube und ähnlichen Videoplattformen wird künftig nur noch nach einer Altersüberprüfung (per E-ID) möglich sein.
- Die E-ID wurde bereits 2021 vom Volk abgelehnt.
Demokratische Abstimmungen haben einen Sinn. Sie legen den politischen Willen des Volks als Souverän in verbindlicher Weise fest und müssen daher Konsequenzen haben. Die Wiedervorlage nahezu identischer Abstimmungsfragen innerhalb weniger Jahre ist aus demokratietheoretischer Sicht unschön, es lässt vermuten, dass „solange gewählt werden soll, bis das Ergebnis stimmt“. Das Volk hat 2021 nicht nur die Online-Zertifizierung durch Konzerne abgelehnt, es hat auch die Einführung der digitalen Identität insgesamt deutlich abgelehnt. Das Votum sollte respektiert werden. Dies kann es nur mit einem NEIN zur E-ID.
- Die E-ID entspricht nicht dem Wunsch der Bevölkerung.
Nach wie vor gibt es ein starkes Bedürfnis nach einer Existenz in Freiheit, fern ab ständiger Überwachung, Datenspeicherung auf Vorrat, digitalen Identitäten und mit einem Fokus auf das analoge Leben, das gleichwertig bleiben soll. Dies zeigte sich klar in den kantonalen Initiativen zur Einführung eines Grundrechts auf digitale Unversehrtheit, die überragend, mit ganz überwiegender Mehrheit angenommen wurden. (Genf: 94%, Neuenburg 91%)
Die E-ID steht für den Gegenentwurf einer rein digitalen, überwachten Welt, die im Namen von Technik und Fortschritt keinerlei Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Bürger nimmt.
Die mit der E-ID vorangetriebene Hyper-Digitalisierung stigmatisiert zudem denjenigen (meist älteren) Teil der Bevölkerung, der schon Mühe mit der heutigen Technik, etwa mit dem E-Banking hat. Dieser darf nicht unterschätzt werden, so haben noch immer 5% der Bevölkerung keinerlei Berührungspunkte mit dem Internet, ein Drittel sieht Digitalisierung gar als ständige Belastung. Diese sollten besser unterstützt werden, nicht ausgeschlossen!
„Gute Digitalisierung braucht keine Überwachung!“
BV-GG-CHEM - 20. Sep, 21:02